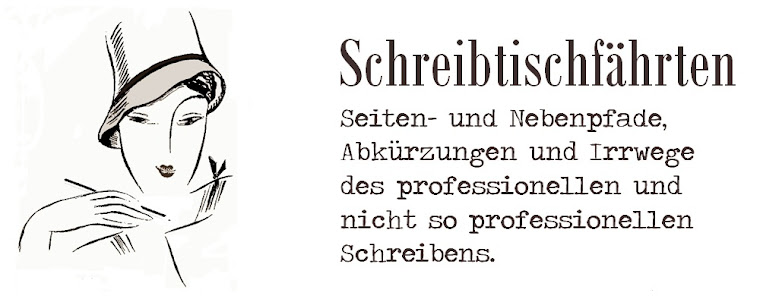|
| Via Graphics Fairy |
In letzter Zeit habe ich einige Instrumente zum effizienteren Schreiben ausprobiert. Zu diesen Selbstversuchen gibt es nun die "Helferlein" Beiträge.
Für konzentriertes, ablenkungsfreies Schreiben wird oft die Verwundung eines Vollbild-Texteditors empfohlen. Das sind Programme, die nach dem Öffnen keinen Zugang zu anderen Anwendungen gestatten, da sie die Menüleisten ausblenden; Befehle werden über die Tastatur eingegeben. Man ist im Schreib-Modus gefangen und hat sozusagen die Bildschirmentsprechung zum leeren weissen Blatt vor Augen. Der kurze Abstecher ins Internet (nur schnell mal die RSS-Feeds/Twitter/die Inbox abrufen) entfällt bzw. ist nur mit einigem Aufwand möglich, der einem bewusst macht, wie leicht man sich ablenken lässt.
Solche Editoren werden gern als Kinkerlitzchen bezeichnet, die mit ein wenig Selbstdisziplin nicht nötig wären. Ein berechtigter Einwand, allerdings fragt man sich, warum der Versuch, zu mehr Selbstdisziplin zu gelangen, dermassen den Zorn der spartanischen Schreibfraktion erweckt. Der Beliebtheit dieser Anwendungen tut das jedenfalls keinen Abbruch. Für Windows gibt es beispielsweise Dark Room oder WriteMonkey, für Mac den WriteRoom und für Linux den TextRoom (links s. unten).
Nicht geeignet sind diese Programme natürlich dann, wenn man während des Schreibens recherchieren möchte - der schnelle Blick auf Wikipedia & Co. ist eben nicht möglich, ebensowenig der Zugriff auf eigenen Datenbanken und Dateien. Allerdings regt das auch einmal zum Nachdenken an.
Nicht geeignet sind diese Programme natürlich dann, wenn man während des Schreibens recherchieren möchte - der schnelle Blick auf Wikipedia & Co. ist eben nicht möglich, ebensowenig der Zugriff auf eigenen Datenbanken und Dateien. Allerdings regt das auch einmal zum Nachdenken an.
Ist es wirklich nicht möglich, einen Text ohne ständigen Zugriff auf andere Texte zu verfassen (Foucault hätte dazu einiges zu sagen)? Ist es wirklich nötig, genau an dieser Stelle zu unterbrechen, nur um beispielsweise ein Datum zu kontrollieren? Könnte man nicht einfach eine Notiz machen und die Recherche später, wenn man den Text zur endgültigen Bearbeitung in ein klassisches Textverarbeitungsprogramm transferiert hat, erledigen? Oder wie wäre es damit, einmal vom Schreibtisch aufzustehen und in einem Buch (!) nachzuschlagen? Und wie wäre es, einfach einmal alle Infos vorab in einem Notizbuch zu sammeln und sich dann erst ans kondensierte Schreiben zu machen? Selbst wenn man mit dem Arbeiten in einem Vollbild-Editor nicht glücklich wird, lohnt es sich doch einmal, diese Erfahrungen zu machen und so die eigene Arbeitsweise zu hinterfragen.
Ich jedenfalls arbeite sehr gerne in diesem Modus. Vor allem dann, wenn es mir schwer fällt, konzentriert zu arbeiten oder in der Anfangsphase eines Projektes, wenn die ersten Sätze einfach nicht kommen wollen. Ich erhalte dann relativ schnell ein brauchbares Textgerüst, dem ich je nach Bedarf in einer anderen Anwendung noch den letzten Schliff verpassen kann.
Nach einigem Umsehen, habe ich mich für Q10 entschieden, weil es verschiedene Schriften und Farben erlaubt und diverse Zusatzfunktionen aufweist wie Statistik, Alarm, Rechtschreibprüfung*, globale Zielsetzung (sehr hilfreich, wenn man ein tägliches Schreib-Soll erfüllen will). Vor allem aber liebe ich Q10, weil man es so einstellen kann, dass es einen wunderbaren Schreibmaschinenton erzeugt, samt "RRR-Ding" beim Betätigen der Zeilenschaltung. Eine kleine Hilfestellung für jene, die nicht (mehr) wissen, wie das klingt:
Das ist nicht nur pure Nostalgie oder Spielerei - es hat etwas ungemein Beruhigendes zu hören, wie der Text wächst und gedeiht. Das Geräusch scheint zudem auch all jene innere Stimmen zu übertönen, die einem sonst beim Schreiben immer wieder zum Innehalten zwingen wollen.
Fazit: Vollbild-Editoren sind nicht geeignet, wenn man beim Schreiben Zugang auf andere Anwendungen braucht. Sie sind aber hervorragende Starthilfen, wenn man mit dem berüchtigten ersten Satz zu kämpfen hat. Sie fördern das konzentrierte Schreiben und retten einem vor den vielen Ablenkungen, die die Arbeit am Bildschirm nun mal bietet. Darüberhinaus bringen sie einen dazu, ausgetreten Schreibpfade mal zu verlassen und neue Zugänge zum Schreiben zu finden.
Q10
WriteMonkey
Dark Room
WriteRoom
TextRoom
*Deutsches Wörterbuch gibt's hier.